Inhaltsverzeichnis
Wieso das Microsoft-Monopol gut für die Kunden ist
In der Ausgabe 01/06 der Zeitschrift Chip argumentiere ich, dass das Microsoft-Monopol für die Anwender etwas Gutes ist. Lassen Sie mich hier einige Hintergründe erläutern.
Natürliches und rechtliches Monopol
Zunächst muss man sich klarmachen, dass Microsoft nicht durch ein Gesetz Monopolist geworden ist, sondern dass sich diese Situation auf dem Markt von allein gebildet hat. Man spricht in diesem Fall von einem „natürlichen Monopol“. Es gibt zwei Gründe dafür:
- • Fixkostendegression
- • Netzwerkeffekte
Die Fixkostendegression ist leicht erklärt. Für die Entwicklung einer Software sind sehr hohe Anfangsinvestitionen notwendig, wogegen das Kopieren der CDs sehr billig ist. Daher werden die Kosten pro Stück immer kleiner, je öfter die Software verkauft wird: Die hohen Fixkosten verteilen sich auf immer mehr Stücke.
Aus diesem Grund kann ein einzelner Anbieter den Markt zu geringeren Kosten versorgen als mehrere parallele Anbieter es könnten. Der Grund ist einfach der, dass dann nur einmal die Entwicklungskosten anfallen. Die Fixkostendegression funktioniert allerdings nur dann, wenn die Betriebsgröße noch klein genug ist, dass nicht schon wieder steigende variable Kosten entstehen, z.B. weil der Abstimmungsaufwand innerhalb der Firma sehr groß wird. Dies ist bei Software jedoch gegeben, denn der reine Vertrieb verlangt keinen großen logistischen Aufwand. Daher kann ein einzelnes Unternehmen den gesamten Weltmarkt zu den geringsten Kosten versorgen. (Es gibt andere Beispiele für Märkte mit starker Fixkostendegression, bei denen aber andere Kosten nach einiger Zeit stark ansteigen: etwa die Bahn, die ein teures Schienennetz hat, das aber sicherlich nicht weltweit von nur einem einzigen Anbieter am kostengünstigsten erstellt werden könnte.)
Das klassische Bild zur Fixkostendegression sieht folgendermaßen aus:
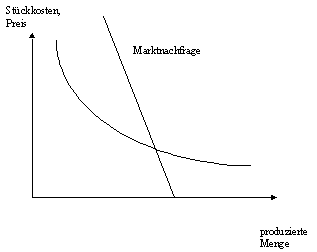
Dies ist die klassische Begründung für ein natürliches Monopol: Wenn die Gesamtnachfragekurve die Durchschnittskostenkurve im fallenden Bereich schneidet, dann erstellt ein Monopol die Güter am billigsten. (Eigentlich genügt schon eine etwas abgeschwächte Bedingung, nämlich dass die Kostenfunktionen einzelner kleiner Anbieter subadditiv sein müssen, worauf ich weiter unten noch eingehe).
Daneben gibt es aber noch einen anderen Grund für ein natürliches Monopol, der nicht zu der klassischen Erklärung gehört:
Netzwerkeffekte beschreiben den Zusammenhang, dass der Nutzen eines Gutes nicht nur vom einzelnen User abhängt, sondern auch von der Verbreitung des Gutes. Ein gutes Beispiel dafür ist ein Betriebssystem: Es reicht nicht, ein gutes System auf seinem Computer zu haben, sondern man muss auch Personal dafür am Markt finden, man muss Dateien austauschen können, man muss sich auf zukünftige Wartung verlassen können – alles Punkte, die davon abhängen, wie weit das System auf dem Markt verbreitet ist. Daher gibt es eine positive Rückkopplung: Je weiter das System verbreitet ist, desto größer ist der Nutzen für den einzelnen User, unabhängig von der eigenständigen Qualität des Systems. Es gibt viele Bereiche, in denen diese positiven Netzwerkeffekte gelten: digitale Speichermedien, Anwendersoftware und Betriebssysteme, Börsen, Videosysteme, Telefongesellschaften usw.
Derartige Märkte streben zu einer kleinen Zahl von Systemen, oftmals zu einem einzigen (es gibt recht klare Kriterien, wann nur eines und wann mehrere Systeme übrig bleiben werden, aber darauf gehe ich hier nicht ein, sondern werde in Zukunft einen anderen Beitrag dazu verfassen).
Wenn diese Netzwerkeffekte vorliegen, dann sind Parallelsysteme eine teure Angelegenheit für die User: Stirbt eines der Systeme im Laufe der Zeit aus (was oft passiert), dann sind die Investitionen der Anwender in dieses System verloren. Aber auch wenn mehrere Systeme dauerhaft bestehen bleiben, tragen die Anwender hohe Kosten, weil sie zum Beispiel nicht problemlos ihre Daten austauschen können oder auf andere positive Netzwerkeffekte verzichten müssen.
Wieso hier ein Monopol gut ist
Wenn es einen Monopolisten gibt, dann verschwinden diese Probleme: Statt teurer Doppelentwicklungen wird nur ein System entwickelt, was zu niedrigst möglichen Stückkosten führt. Besser noch: Es gibt auch nicht den Fall, dass ein System ausstirbt und alle User um ihre Investitionskosten bringt, die auf dieses System gesetzt haben. Auch gibt es nicht das Problem inkompatibler Systeme am Markt, die ebenfalls nachteilig für die User sind.
Bitte beachten Sie aber, dass diese Vorteile an ganz spezielle Voraussetzungen geknüpft sind: Es muss sich um Branchen handeln, in denen die Fixkostendegression und positive Netzwerkeffekt eine wesentliche Rolle spielen. Beim klassischen Handwerksbetrieb oder in der Landwirtschaft zum Beispiel ist beides nicht erfüllt. Das ist der Grund, weshalb diese Argumente in der klassischen Wirtschaftstheorie keine Rolle spielen. Allerdings sind diese beiden Merkmale typisch für viele moderne Branchen, die daher auch zeitweise das Label New Economy bekommen hatten, für die alles anders sei. Heute wissen wir: es mag Vieles anders sein, aber nicht alles; das ändert aber nichts daran, dass zumindest diese beiden Effekte sind tatsächlich anders sind als in der klassischen Old Economy.
Aber wieso haben wir dann so viel Angst vor Monopolen?
Ganz einfach: weil ich Ihnen bisher nur die halbe Geschichte erzählt habe. Ich habe bisher lediglich gezeigt, dass es Kostenvorteile eines Monopolisten gibt. Ich habe nicht gezeigt, dass diese auch bei den Konsumenten ankommen; was sollte denn dazu führen, dass diese Vorteile nicht in den Taschen des Monopolisten verschwinden?
Wir alle erinnern uns nur ungern an die Bahn, die Energieversorger und die Deutsche Bundespost (Geschäftsbereich Telekommunikation), die uns viele Jahre veraltete Produkte bei schlechtem Service und überhöhten Preisen geliefert haben und teilweise weiterhin tun. Und das, obwohl es in allen Fällen klare Fixkostengeschäfte sind, bei denen nicht zwei Schienen- oder Kabelnetze parallel bestehen sollten. Der Grund ist ein recht einfacher: Der Gesetzgeber hatte diese Monopole zu rechtlichen Monopolen erklärt.
Genau das war aber das Falscheste, was man tun konnte. Denn dadurch wurde ein Monopolist geschützt, der gar nicht geschützt werden brauchte, weil der Markt ohnehin nur Platz für einen Anbieter lässt (weil es eben natürliche Monopole sind). Was diese rechtliche Beschränkung aber bewirkt hat, war eine Abschottung vor auch nur potenzieller Konkurrenz. Diese kann aber Wunder wirken: Wenn der Monopolist übertreibt, dann könnten spielend neue Konkurrenten auf den Markt eindringen und an seinem guten Geschäft teilhaben. Schlimmer noch: wenn er nicht schnell genug reagiert, dann könnten sich die Konkurrenten etablieren und plötzlich die Betriebsgrößenersparnis auf ihrer Seite haben.
Exakt dies ist der Inhalt der Theorie der contestable markets, der angreifbaren Märkte. Sie besagt, dass gar keine tatsächliche Konkurrenz nötig ist, damit der Monopolist seine Kostenvorteile weitergibt, sondern dass bereits latente Konkurrenz genügt. Um diese abzuwehren setzt der Monopolist von vornherein niedrige Preise fest. Entscheidend ist also, ob der Markt durch Eintrittsbarrieren abgeschirmt ist oder ob er angreifbar ist – daher der Name der Theorie. (Oft findet man die Übersetzung „bestreitbare Märkte“; das ist ein Übersetzungsfehler, der darauf zurückzuführen ist, dass in alten Wörterbüchern das englische Wort contestable nur mit bestreitbar übersetzt wurde, was jedoch ein juristischer Begriff ist, der hier überhaupt nicht passt).
Jedenfalls ist also für das Weitergeben der Kostenvorteile die Angreifbarkeit wichtig. Viele Theoretiker argumentieren, dass diese bei Software nicht gegeben sei, weil die Entwicklungskosten nicht nur Fixkosten sind, sondern auch Sunk-costs (versunkene Kosten), die in jedem Fall verloren sind, nachdem die Investition getätigt ist – und zwar unabhängig davon, ob sie den gewünschten Erfolg gebracht hat oder nicht. Daher seien diese Märkte mit einer hohen Eintritts- (bzw. Austritts-) Barriere ausgestattet, die die potenzielle Konkurrenz unmöglich machen. Exakt aus diesem Grund gibt es inzwischen auch statt der ehemaligen Staatsmonopole nun das Gegenteil in Form der Bundesnetzagentur, deren Aufgabe darin besteht, den Wettbewerb in den Bereichen der ehemaligen Staatsmonopole sicherzustellen.
Diese Argumentation übersieht aber, dass es auf dem Softwaremarkt gleichzeitig die positiven Netzwerkeffekte gibt. Damit gibt es zwar nach wie vor Eintrittsbarrieren, aber gerade für Teilsegmente oder für neue Nischen hat ein Eindringling eine echte Chance, wenn der Monopolist etwas zu lange nicht aufpasst. Das passiert immer wieder: Erst kürzlich hat die Stuttgarter Börse der Deutschen Börse das Teilsegment des Optionsscheinhandels abgenommen, obwohl die Deutsche Börse ein klassisches natürliches Monopol ist.
Nachdem man nun auf Softwaremärkten nicht beobachten kann, dass die Preise überhöht sind, argumentieren gern dieselben Theoretiker, die über Marktzutrittsschranken klagen, dass das Abwehrverhalten des Monopolisten Dumping sei. Aber war das nicht genau das, was wir wollten? Dass der Monopolist die niedrigst möglichen Preise setzt, um seine Kostenvorteile an uns weiterzugeben?
Und damit schließt sich der Kreis: Ein Monopolist kann den Markt zu niedrigsten Kosten versorgen; er gibt diesen Kostenvorteil auch an die Konsumenten weiter, weil er die potenzielle Konkurrenz abwehren will, auch wenn sie noch gar nicht da ist. Wenn das Dumping ist, dann sei’s drum: Wir Anwender bekommen was wir wollen und das auch noch billiger als jede andere Marktform es könnte. Und wir brauchen nicht ständig zu zittern, ob sich auch wirklich das System am Markt durchsetzt, auf das wir gesetzt haben.
Für Skeptiker
Mich haben inzwischen zahlreiche Zuschriften zu diesem Artikel erreicht. Auf einige Anmerkungen möchte ich hier eingehen.
Gilt das immer?
Leider nein. Auch damit ich nicht als „Professor Monopol“ eingestuft werde, hier der dezente Hinweis, dass ich mir der Gefahren dieser Marktform durchaus bewusst bin – siehe meine Ausführungen zum Politik-Kartell. Aber die Rahmenbedingungen sind entscheidend, und die sind im Falle von Software recht speziell, wie ich hoffentlich überzeugend gezeigt habe.
Sind die Entwicklungskosten wirklich so hoch, dass sie den Effekt der Kostendegression erklären könnten?
Der Software-Experte und Vorsitzende des Computerclubs AUGE e.V., Florian Delonge, hat mir den Hinweis geschickt, dass die Entwicklungskosten in der Software-Branche nur bei 10 bis 20% des Umsatzes liegen, wogegen die Kosten für Vertrieb und Marketing stark mit der Größe des Unternehmens anwachsen (insbesondere durch die Personalkosten), somit also ein Großteil der Kosten variabel und eben nicht fix ist. Daher scheinen meine Schlussfolgerung auf einer falschen Voraussetzung zu basieren. Aber dieses Argument ist nicht so gefährlich wie es auf den ersten Blick aussieht.
Ich habe oben argumentiert, dass wir es in der Software-Branche mit einer starken Fixkostendegression zu tun haben, weil sich die Entwicklungskosten bei höherer Stückzahl auf eine größere Menge verteilen. Nehmen wir ruhig einmal an, dieser Effekt sei in Wahrheit sehr gering und fragen uns, welcher Art die variablen Kosten sind. Ganz klar sind dies die Marketing- und Vertriebskosten sowie die Kosten für den Support, einschließlich Fehlerbeseitigung und Hilfen bei Problemen. Vergleichen wir nun diese Kosten, wenn Microsoft der Softwarehersteller ist oder wenn es – sagen wir einmal – Riecksoft ist. Microsoft hat eine große Markenbekanntheit, Riecksoft nicht – wer wird wohl die höheren Marketingkosten pro abgesetzter Menge haben? Trennen wir ruhig den Vertrieb vom Marketing und fragen uns, wer die höheren Vertriebskosten pro abgesetzten Exemplars Software haben wird: Microsoft oder Riecksoft? Microsoft-Produkte sind weit verbreitet und daher vielen Personen im Markt bekannt. Wenn man ein (Anfänger-) Problem hat, kann man in aller Regel einen Bekannten fragen, wenn man ein komplizierteres Problem hat, kann man einen von vielen Computer-Doktoren beauftragen. Wie sieht das bei Riecksoft aus? Muss man hier nicht in beiden Fällen einen teuren Spezialisten bezahlen, der auch noch schwer zu finden sein wird, was die effektiven Kosten für die Kunden noch einmal erhöht?
Man sieht hier Folgendes: Selbst wenn die Stückkosten mit zunehmender Menge nicht fallen, so hat ein großes Unternehmen doch geringere Gesamtkosten als viele kleine Unternehmen zusammen, die gemeinsam die gleiche Menge produzieren. Man nennt dies subadditive Kostenfunktionen, weil sie sich nicht einfach addieren, wenn sie zusammengelegt werden, sondern unter diesem addierten Wert bleiben. Schon dies genügt, damit es zu einem natürlichen Monopol kommen kann. (Mehr darüber im Beitrag über Kostenfunktion und Betriebsgrößenersparnis.)
Nehmen Sie zum Vergleich einen Dachdeckerbetrieb. Vielleicht sind hier die Kosten ebenfalls subadditiv, wenn die Betriebsgröße von einem auf zwei Mitarbeiter anwächst. Aber sind sie es auch noch beim Übergang von 1000 auf 1001 Mitarbeiter? Oder könnte es dort passieren, dass der Koordinationsaufwand viel schneller ansteigt als die Einsparungen aus der Betriebsgröße? Zudem hängt der Nutzen von Dachdeckerarbeiten keineswegs davon ab, wie viele andere Hausbesitzer denselben Dachdeckerbetrieb für ihre Dächer beauftragt haben. Mit anderen Worten: Hier ist die Situation grundverschieden, und es liegt der klassische Fall vor, der zu einem Nebeneinander von vielen Betrieben führt.
Und – wohlgemerkt – bei dieser Argumentation wurde noch überhaupt nicht berücksichtigt, dass es auch noch die positiven Netzwerkeffekte gibt, sprich, dass der Nutzen für die Anwender mit zunehmender Verbreitung steigt. Daher ist das Produkt von Riecksoft nicht nur teurer in der Produktion, sondern auch noch „schlechter“, und zwar selbst dann, wenn die meisten Anwender für sich allein genommen es lieber hätten, dass Riecksoft das weiter verbreitete Produkt hat.
Aber die Microsoft-Produkte sind doch so schlecht! Daher kann die Theorie gar nicht stimmen!
Viele Mails, die mich zu diesem Beitrag erreichen, bringen dieses Argument in den verschiedensten Abwandlungen vor: Microsoft imitiert doch nur Andere, Microsoft ist zu wenig innovativ, Microsoft kann dieses nicht und jenes schlecht. Interessanterweise hat mir noch niemand geschrieben, Microsoft-Produkte seien zu teuer. Deutet das nicht stark darauf hin, dass es tatsächlich einen Kostenvorteil gibt, und dieser auch noch (zumindest teilweise) an die Kunden weitergegeben wird?
Auch möchte ich nochmals betonen, dass dies hier kein Plädoyer für die Firma Microsoft ist. Statt dessen plädiere ich dafür, in Märkten mit den oben genannten Eigenschaften (also subadditive Kostenfunktionen und positiven Netzwerkeffekten) die Monopolbildung einfach zu akzeptieren und anzuerkennen, dass dies besser für die Anwender ist als eine erzwungene Konkurrenz. Ob am Ende IBM, Canon, SAP, Wikipedia oder Riecksoft der Monopolist wird, ist nebensächlich. Wichtig ist lediglich, dass man den Monopolisten dazu bringt, die Kostenvorteile auch an die Konsumenten weiterzugeben.
Ach ja: wieso mögen wir Microsoft eigentlich nicht? Im Alltag gibt es genug Gründe, sich über seinen Computer zu ärgern. Und von wem ist dann das Programm, das gerade einmal wieder abstürzt? Natürlich von Microsoft! Also ärgern wir uns über Microsoft. Und merken gar nicht, wie sehr wir uns ärgern würden, wenn es nicht Microsoft, sondern viele kleine andere Unternehmen gäbe.
Aber wieso wird dann staatlich gegen Monopole vorgegangen?
Erstens: Weil die obige Argumentation nicht für jedes Monopol gilt (auch nicht für jedes natürliche Monopol), sondern nur in besonderen Fällen. Zu diesen Fällen gehört aber ganz klar die Software-Branche. Zu anderen Bereichen werde in Zukunft noch Stellung nehmen. Zum Quasi-Monopol in der Politik habe ich schon Stellung genommen, aber seltsamerweise hat das die Menschen bisher weniger interessiert als der Fall Microsoft (oder haben wir bei der Politik schon resigniert?).
Zweitens: Weil die Wettbewerbsaufsicht von Juristen dominiert wird und nicht von Ökonomen. Juristen wollen gern klare Regeln, an denen Sie ein Monopol erkennen können; Ökonomen fragen lieber, ob und wann ein Monopol überhaupt schädlich ist. Hier liegt der Streitpunkt. Denn meine Argumentation ist überhaupt nicht neu – aber sie ist den Juristen suspekt. Ökonomen sehen die potenziellen Vorteile von Monopolen durchaus. Eine bekannte Position von Industrieökonomen lautet: „Nicht die Wettbewerber schützen, sondern den Wettbewerb“. Aber es dauert ein wenig, diese Position zu erklären – und damit sind wir beim nächsten Grund:
Drittens: Politik handelt gern „populistisch“. Die meisten Menschen mögen Microsoft einfach nicht. Wenn nun ein Politiker ausgerechnet diesen Konzern verteidigt, dann bringt das nicht gerade Wählerstimmen. Wozu sollte man also eine komplizierte Argumentation vorbringen, die im Resultat die Menschen nur gegen sich aufbringt? Ein Professor kann (und soll) so etwas tun. Ich kann es ertragen, wenn ich in vielen Internet-Foren der meistgehasste Wirtschaftswissenschaftler bin. Ich bin aber auch nicht von Wählerstimmen abhängig.
Viertens: Von klein auf wird uns schon in der Schule eingebläut, wie schlimm Monopole sind. Wie sollen wir auf einmal verstehen, dass es unterschiedliche Formen von Monopolen gibt, und einige davon „gut“ sind? Besonders, wenn die Begründung dafür mehrere Minuten dauert und dann noch ausgerechnet Microsoft als Gewinner daraus hervorgehen soll?
Und was hat das alles mit Spieltheorie zu tun?
Ganz einfach: Die Spieltheorie beschäftigt sich mit Situationen, in denen mehrere vernunftbegabte Entscheider gemeinsam ein Ergebnis (ein Spielausgang) hervorbringen, das dann für alle gilt. Genau das ist hier der Fall: Microsoft ist ein Entscheider, die potenziellen Konkurrenten sind Entscheider, die Anwender sind es ebenfalls. Keiner kann allein bestimmen, wie das „Spiel“ ausgeht, sondern der Ausgang hängt von allen gemeinsam ab. Genau davon handelt die Spieltheorie. Mehr dazu finden Sie in meiner Einführung in die Spieltheorie und noch mehr in meinem Spieltheorie-Buch.
Offene Fragen
Mir sind keine genauen Zahlen über die Kostenstruktur in der Softwarebranche bekannt. Falls jemand genauere Untersuchungen hierzu kennt, dann wäre ich dankbar, wenn Sie mir hierzu eine Quelle schicken könnten.
Möchten Sie diesen Beitrag kommentieren?
Dann schreiben Sie mir ein Mail. Ich arbeite Ihren Kommentar gern in diese Seite ein: info (at) rieck.de